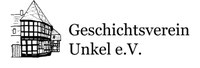"Die Abrissaffäre" - Abbruch der denkmalgeschützten Knabenschule und der Küsterei im Jahre 1913...

Am 10. Dezember 1913 erfuhr der Unkeler Bürgermeister Gustav Biesenbach durch eine kurze Notiz des Vorstandes der katholischen Kirchengemeinde, dass die Küsterei wegen Baufälligkeit abgerissen wird. Das Gebäude war 1612 als Knabenschule direkt hinter dem Chor der Sankt Pantaleonkirche errichtet worden. Biesenbach war überrascht und schaute sich die Baustelle sofort vor Ort an. Der Abriss war bereits zu ¾ vollendet.

Sein 1. Beigeordneter, der Steinbruchbetreiber Heinrich Hattingen, der auch maßgeblich im Kirchenvorstand wirkte, hatte ihn nicht vorher informiert. Das war vermutlich dem Umstand geschuldet, dass Bürgermeister Biesenbach ziemlich oft nicht in Unkel war und die Amtsgeschäfte häufig seinem Beigeordneten Hattingen überlies. Die Unterschriften unter den Amtsakten aus dieser Zeit zeigen dies deutlich.
Die Situation war für Biesenbach sehr unangenehm, denn für den Abriß des in der Denkmalliste der Rheinprovinz aufgeführten historischen Gebäudes hätte unbedingt zuvor eine Genehmigung eingeholt werden müssen. Es handelte sich immerhin um die ehemalige Knabenschule, die über 200 Jahre lang bis zum Neubau der Volksschule an der Linzer Straße ( heute „Altes Rathaus“) 1855 dem Unterricht der Knaben im Kirchspiel Unkel-Rheinbreitbach gedient hatte.
Nach dem Umzug der Schule hatte die katholische Kirchengemeinde das Gebäude weiter als Wohnhaus des Küsters genutzt. Bis 1870 versah nämlich der im Schulhaus wohnende Lehrer gemeinhin auch die Aufgaben des Küsters.
Bürgermeister Biesenbach musste den Vorgang an den Landrat Kurt von Elbe in Neuwied-Heddesdorf melden und bekam prompt noch vor Weihnachten einen gehörigen Rüffel:
„Es sei ganz unverständlich, wie ein der dortigen Kirchengemeinde gehöriges Gebäude ohne Ihr Wissen abgebrochen werden konnte“.
Der Landrat trug ihm auf, alle erhaltenswerten Teile aus dem Abbruch zurückzuhalten und wenn irgend möglich bei dem projektierten Anbau wieder verwenden zu lassen. Dieses Projekt sei im Landratsamt zur Genehmigung vorzulegen.


Die Weihnachtsfeiertage hat der Bürgermeister sehr wahrscheinlich mit der Formulierung eines ausführlichen Berichts verbracht, der am 29. Dezember 1913 an den Landrat abging.
Es hatte sich herausgestellt, dass der Kirchenvorstand mit einem örtlichen Bauunternehmer den Vertrag über den Abriss und die Wiederverwendung des Materials geschlossen hatte, ohne den Sekretär im Bürgermeisteramt zu informieren. Dazu muss man wissen, dass der langjährige Streit während des „Kulturkampfes“ zwischen Kirchengemeinde und Zivilgemeinde, wer Eigentümer der Knabenschule sei, wohl noch nachwirkte.
Biesenbach schrieb zu seiner Rechtfertigung, dass das Gebäude tatsächlich marode war.
Das Holzwerk sei total faul und vermorscht und für nichts mehr zu gebrauchen. Grund dafür sei der lange Leerstand. Außerdem seien 1911 bei dem Abriß des angrenzenden Gutshofs erhebliche Schäden an dem Gebäude verursacht worden.
Die Kirchengemeinde habe ihn gleichwohl überraschend vor vollendete Tatsachen gestellt und er wisse nicht, was er hätte anders machen sollen. Von einem projektierten Anbau sei ihm auch nichts bekannt.
Landrat von Elbe ließ Gnade vor Recht ergehen und beließ es bei einer Ermahnung.
Allerdings wurde durch diese Episode deutlich, dass Bürgermeister Biesenbach offenbar ein erhebliches Kommunikationsproblem hatte. Als der bald darauf ausbrechende Weltkrieg große Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung mit sich brachte, zeigte sich das deutlich.
Unausgesprochen bei der Abrissaffäre blieb im übrigen das eigentliche Motiv des Kirchenvorstandes: der Friedhof benötigte dringend mehr Fläche.